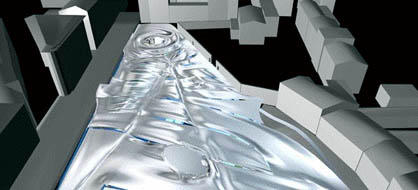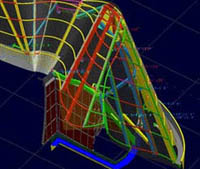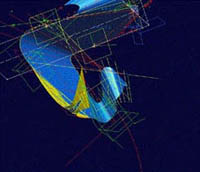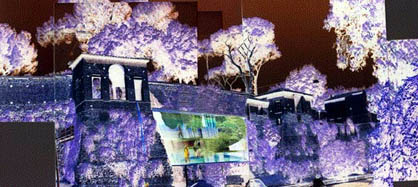[in
italiano]
[in
english] |
|
In diesem
Beitrag möchte ich der Frage nachgehen, welche Entwicklungen
sich für die Architektur in den kommenden Jahren vorhersagen
lassen. Und um es noch konkreter zu machen: in den nächsten fünf
Jahren, so dass wir 2006 das tatsächlich Erreichte rückblickend
überprüfen können.
Diese Frage scheint zunächst einen Aspekt zu vernachlässigen,
der in Wirklichkeit entscheidend ist. Wir sprechen von Digitaler
Architektur oder von Computer und Architektur ausschliesslich
als Mittel, um ein neues Zeitalter der Architektur zu erlangen. Die
Formel "IT-Revolution in Architecture" betont die Beschleunigungsrate,
die wir zur Zeit erleben.

Oosterhuis.nl, Noord-Holland Pavillon für die Ausstellung
Floriade 2002.
Sie beschreibt eine Revolution aller modernen Herstellungsprozesse,
mit erkennbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen, und wie diese
Ausstellung beweist, ist sie mittlerweile reif, für alle Architekten
zu einem Thema zu werden.
Natürlich müssen wir, bevor wir überhaupt mit der Beantwortung der
Frage beginnen, welche Entwicklungen wir erwarten, etwas ausholen,
um klarer zu sehen: Ich schlage vor, zwei entscheidende Wendepunkte
zu betrachten: 1926 und 1997.
DIE WIEDERENTDECKUNG DES ERZÄHLENS. 1926 wurde das neue Bauhause eingeweiht.
In Dessau wurden alle Brücken zur traditionellen Baukunst rigoros
abgebrochen. Das neue Gebäude zeigt vor allem, dass man sich von Gebäudetypologie,
struktureller Kontinuität, urbaner Morphologie, perspektivischem Rahmen,
historischem Stil und schließlich einem Verständnis von Architektur
als "Kathedrale" mit symbolischer und kommunikativer Aufladung verabschiedet
hatte. Dies war ein schmerzlicher Verzicht, besonders weil das Bild
einer Kathedrale von Feininger ein Bestandteil des ersten Manifests
und Programmheftes des Staatlichen Bauhauses war, das 1919 vom damaligen
neuen Direktor aufgestellt wurde. Walter Gropius bekräftigte darin
unter anderem, dass "die neue Architektur [...] gen Himmel steigen
wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens." (Stiftung
Bauhaus Dessau, Margret Kentgens-Craig (Hrsg.), das bauhausgebäude
in dessau 1926-1999. Basel, Berlin, Boston 1998, S. 6)

Lyonel Feininger, Kathedrale,
Titelholzschnitt des 1.
Programms des Staatlichen
Bauhauses, April 1919.
Aus der Sicht unseres heutigen Interesses ist gerade das Verschwinden
der Kathedrale der entscheidende Wendepunkt. Die Architektur der Moderne
konnte ihre Funktion nur tautologisch vermitteln. Die endgültige Form
definierte sich über abstrakte Zeichen (Pilotis, Fläche, Glasschlitze),
die wie Teile aus einem Baukasten auf der Grundlage rein syntaktischer
Regeln zusammengefügt waren. Von der postmodernen Geschichtsschreibung
"Verbot der Form" genannt, hatte dieses Verfahren tiefere Gründe,
weil sie für die Logik stand, mit der Maschinen konzipiert, entworfen
und konstruiert wurden.
Aber als die Parameter für eine Objektivierung der Funktionen
- standardisierte Elemente, Grundriss-Typisierung und Vorfertigung
- zusammen mit dem gesamten industriellen Produktionssystem in die
Krise gerieten (diese Krise trat bekannterweise vorwiegend in den
siebziger und achtziger Jahren auf) kehrte zurück, was zuvor
ausgeschlossen war: die narrative, symbolische und kommunikative Bedeutung
von Architektur.
Der Beginn dieses Prozesses der Wiedereinführung von Bedeutung
und Symbol in die aus der Moderne hergeleiteten Sprache antizipierte
1956 Jørn Utzon mit seinem Opernhaus in Sydney. Aber erst vor
kurzem entfaltete dieser Prozess seine volle Wirkung. 1997 wurde zum
ersten Mal allen klar, dass die Architektur ihren öffentlichen
Kommunikationswert in vollem Umfang zurückgewonnen hatte - oder,
abschätzig ausgedrückt, ihren Vermarktungswert. Als Beweis
dafür wurde aus vielerlei Gründen das Guggenheim-Museum
in Bilbao herangezogen (aber wir könnten das Gleiche auch vom
Science Museum in Amsterdam oder dem Jüdischen Museum in Berlin
sagen). Heute fährt alle Welt nach Bilbao, als gelte es, eine
Pilgerreise zu dieser laizistischen Kathedrale der Kultur, entworfen
in einer zeitgenössischen Sprache, zu unternehmen. Aber was hat
das mit Digitaler Architektur zu tun, mit der Architektur der Information
und vor allem mit der Zukunft und den Entwicklungen, auf die wir hoffen?
KOMMUNIKATION UND INFORMATION. Diese Rückkehr der Kommunikation
im großen Stil als treibende Kraft einer neuen architektonischen
Ära ist strukturell mit der IT Revolution verbunden. Dieser Aspekt
wird häufig unterschätzt und falsch verstanden.

Fredy Massad, New Yorker Frühling,
1996.
Die Kartoffel, die wir im Supermarkt kaufen, besteht zu neunzig Prozent
aus Information (Forschung, Vermarktung, Vertrieb). Das Gleiche gilt
sogar noch in größerem Maß für elektrische Haushaltsgeräte
oder Autos, und immer mehr Menschen produzieren heute Waren, die "reine"
Information sind. Die Information ist der wahre Mehrwert jeder Ware.
Sie ist das, was sie konkurrenzfähig macht. Information bedeutet
auch Erzählung, Bild und Design. Man denke an eine Uhr, an ein
Auto oder mittlerweile auch an Architektur. Gekauft wird zuerst die
Erzählung, die Lifestyle-Utopie, dann erst die Form, während
man selbstverständlich davon ausgeht, dass das Produkt auch funktioniert.
Die Verpackung trägt gegenüber dem Inhalt bei weitem den
Sieg davon.
NEUE THEMEN.Aber offensichtlich ist diese erste narrative und metaphorische
Ebene nur der Anfang und, wenn man so will, besteht nur eine sehr
oberflächliche Beziehung zwischen Architektur und IT Revolution, welche
die eigentlichen Kernthemen nicht berührt, die heute zur Debatte stehen.
Eine Paraphrase für unsere jetzige Situation stellt Bruno Tauts Glashaus
bei der Werkbundschau von 1914 in Köln dar.

Bruno Taut, Glashaus, Deutsche Werkbundausstellung,
1914.
Damals war der Einsatz von Glas und Transparenz wie eine romantischer
Lobgesang, eine expressive und poetische Inspiration, ohne Einfluss
auf die eigentlichen Themen, auf die es damals ankam. Um zu verstehen,
wie Glas und Transparenz zu Katalysatoren einer neuen architektonischen
Vision werden konnten, mussten wir erst auf die Bauhaus-Bewegung warten.

Walter Gropius, Bauhaus, 1926 Dessau.
In Dessau wird die Transparenz zum eigentlichen Thema von Gropius'
Botschaft, ein ästhetisches, formgebendes, funktionales und philosophisches
Thema. Denn für Gropius war Transparenz die Versachlichung der Funktion
selbst, die Fähigkeit der Architektur, "jeden kommunikativen Aspekt"
zu annullieren und eben nur sich selbst zu repräsentieren. Wenn es
diese Transparenz nicht gäbe, besäße die Neue Sachlichkeit keine Ästhetik,
nur Ethik.
DAS NEUE "WIE". Ein weiterer Vergleich mit dem Bauhaus ist nötig,
weil die Architektur, die in den nächsten Jahren gebaut werden wird,
überwältigend und dramatisch anders sein wird als die der Moderne.
Gropius besiegte den fünfköpfigen Drachen der traditionellen Architektur,
indem er folgende Prinzipien verfolgte: 1. freie Baukörper für jede
Funktion statt vorgegebene Grundrisse für individuelle Typologien;
2. eine zentripetal ausgreifende Raumkonzeption statt geschlossener
Blockstrukturen; 3. Skelettbauweise statt Massivbau; 4. dynamische
statt einer bildhaften, in der Tradition und Renaissance-Perspektive
verankerten Sprache und 5. die Beseitigung jeder Form von Symbolik.

Greg Lynn FORM & Fabian Marcaccio, The Predator,
Installation für die Ausstellung Suite Fantastique, Wexner
Center for the Arts, Columbus, Ohio, 2001.
Heute versuchen wir zu verstehen, wie die gleichen Elemente, die Gropius
und, in unterschiedlicher Ausformung, Mies van der Rohe oder Mendelsohn
und andere entdeckt haben, sich erneut radikal ändern werden.
Und ändern müssen sie sich zwangsläufig, da der Ausbruch
technologischer Innovationen, wie gezeigt, unvermeidliche Auswirkungen
auf unsere Disziplin haben wird.
Mies van der Rohe sagte 1930 beim Abschluss des Werkbundkongresses
in Wien: "Die neue Zeit ist eine Tatsache; sie existiert ganz
unabhängig davon, ob wir "ja" oder "nein"
zu ihr sagen. Aber sie ist weder besser noch schlechter als irgendeine
andere Zeit. Sie ist eine pure Gegebenheit und sich wertindifferent.
[...] Nicht auf das "Was", sondern einzig und allein auf
das "Wie" kommt es an." (Fritz Neumeyer, Mies van der
Rohe. Das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst. Berlin 1986,
S. 372)
Nun hat meine Generation von Architekten und Kritikern bereits begonnen,
über das "Wie" des neuen Informationszeitalters etliche
Ideen zu entwickeln. Einige davon sind bereits fest umrissen.
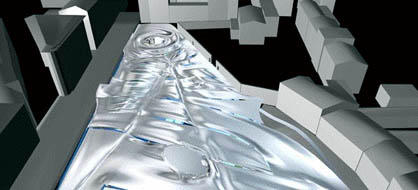
Pongratz+Perbellini Architetti, Piazza cittadella,
Verona.
Die freie Entfaltung der Funktionen, die aus einer industriellen Perspektive
von einer sich ausdehnenden Maschine verkörpert wurde, tendiert
immer mehr dazu, durch eine Logik der Zwischenräume ersetzt zu
werden. Es besteht die Tendenz, "dazwischen" zu arbeiten,
auch weil uns aufgrund bereits bestehender Gebäude gar keine
andere Wahl mehr bleibt. Das Konzept effizienter Tragwerke wird ersetzt
durch die Formel "Ingenieurtechnik ist die Kunst des Möglichen".

Frank O. Gehry and Associates.
Experience Music Project in Bau,
2000 Seattle (Photo B. Lindsey).
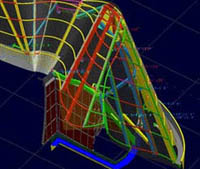
Frank O. Gehry and Associates.
CATIA Zeichnung, Fachbereich
Weatherhead School of Management
der Case Western Reserve University,
Fertigstellung 2002, Cleveland.
Konstruktionen können jede Form annehmen und in jeder erdenklichen
Weise ausgeführt werden. Werfen wir erneut einen Blick nach Bilbao
(auch weil in vielen Fällen die Baukosten prozentual niedriger sind
als in der Vergangenheit), an die Stelle der zentripetal ausgreifenden
Raumkonzeption von Gropius treten viele andere, die auf die Formen
des Palimpsests, der Spirale und partieller Vertiefungen basieren
und die einer Raumkonzeption als einem System von interagierenden
Kräfte zwischen Innen und Außen Gestalt verleihen. Die Maschine, die
sich frei in den umliegenden Raum ausdehnt, gibt es nicht mehr, sondern
nur noch eine Reihe von Wechselbeziehungen zwischen den Dingen. Zugespitzt
formuliert gibt es keine Grundelemente mehr (Atome, Funktionen, Flächen),
sondern nur noch "Verbindungen". Schließlich ersetzen wir eine Stadt,
die selbst so entworfen ist, als wäre sie ein Fließband (hier wohnt
man, dort arbeitet man, hier ruht man sich aus, dort erholt man sich),
durch eine immer vermischtere, hybridere, multifunktionalere Stadt,
die 24 Stunden "geöffnet" ist ohne Nutzungszuweisungen auskommt.
ÜBER INTERAKTIVITÄT. Wir sind im Begriff, Gropius' Erkenntnisse
vollständig zu ersetzen, nicht weil sie uns nicht gefallen (im
Gegenteil, wir schätzen sie vielmehr wie wir auch Piero, Michelangelo
oder Caravaggio schätzen), sondern weil sich unsere heutige Welt
völlig verändert hat.
Wir fragen uns nicht, wie Architektur entstehen kann, die Information
nur oberflächlich als Kommunikation oder Erzählung benutzt
-wie in den neunziger Jahren geschehen-, sondern im Gegenteil, wie
kann Information zur eigentlichen Essenz von Architektur werden.
Wenn es einerseits richtig ist, dass Information die Triebkraft allen
Wandels ist (ihre Katalogisierung, Verbreitung, Übertragung und
vor allem Formalisierung) und es ebenfalls korrekt ist, dass der Motor,
der diese neue Entwicklung erst ermöglicht hat, die elektronische
Digitalisierung von Daten ist (in allen Bereichen und auf allen Gebieten),
so ist es andererseits auch wahr, dass diese beiden Komponenten trotz
ihrer enormen Auswirkungen nicht ohne den denkenden Geist existieren
würden, und das stellt das eigentliche Thema der Informationsrevolution
dar.
Dieser Geist besteht bekanntlich aus der dynamischen Verknüpfung
von Daten. Wir haben heute die Möglichkeit, extrem flexible Modelle
zu schaffen, die von einer oder mehr Parametern gesteuert werden und
bei der Veränderung einer einzigen Informationseingabe unterschiedliche
Welten generiert. Wir sind in eine Informationswolke eingetaucht,
die im ständigen Wandel begriffen ist.
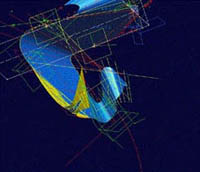
Frank O. Gehry and Associates.
Durch CAD-Software wird der
Entwurf von "Hüllen" vereinfacht.
Den Weg, um dies in Architektur, also das offenbar Statischste, was
es gibt, zu übersetzen, haben wir bereits seit einigen Jahren aufgezeigt
- ebenso wie eine kleine Pioniergruppe von Architekten, von denen
die meisten hier vertreten sind. Dieser Weg heißt Interaktivität und
wird die Position einnehmen, die der Transparenz in Gropius' Neuer
Sachlichkeit zukam.
INTERAKTIVITÄT. Interaktivität in der Architektur bezeichnet
mindestens drei verschiedene Dinge von zunehmend höheren Ebenen
von Komplexität, wobei die komplexeste Ebene die körperliche
Interaktivität ist, welche die beiden vorangehenden beinhaltet.
Aber gehen wir der Reihe nach vor. Körperliche Interaktivität
heißt, dass sich die Architektur selbst ändert. Wir wissen,
dass es bereits intelligente Häuser gibt, in denen sich das Ambiente
je nach Situation verändert. Da gibt es das Gäste-Szenario,
bei dem die Lichter automatisch gedimmt werden, sich einzelne Türen
öffnen, sich Schiebewände oder abgehängte Decken bewegen
und Raumtemperatur und Belüftung geregelt werden. Vielleicht,
und dies ist durch die Einführung von Mikrofasern in der Inneneinrichtung,
Glas und sogar in neuen Marmorsorten wahrscheinlicher geworden, werden
sich auch die physischen Eigenschaften der Wände interaktiv im
Hinblick auf Textur, Porosität und die Fähigkeit, Geräusche
oder Farben zu absorbieren, verändern. Zahllose andere Szenarien
sind möglich. Damit zu beginnen, diese Ideen in breiterem Umfang
in die Praxis umzusetzen, ist eines der wünschenswerten Ergebnisse
der Architektur in den nächsten fünf Jahren. Sie könnten
dann nicht nur, wie heute, in den Häusern der Wohlhabenden Anwendung
finden, sondern immer häufiger in öffentlichen Gebäuden,
Museen und bestimmten Stadtteilen. Ich bin mir fast sicher, dass wir
bis 2006 in dieser Hinsicht auch bereits Anzeichen für ein reifendes
"ästhetisches" Bewusstsein geben wird.

NOX (Lars Spuybroek mit Pitupong Choawakul, Norbert
Palz, Wolfgang Novak and Joan Almekinders) mit dem Künstler Q.S. Serafijn,
Interaktiver Turm für die Stadt Doetinchem, 1998.
Aber Interaktivität hat jenseits der effektiven Veränderung der Architektur
noch zwei weitere, niedrigere Ebenen, die einfacher zu erreichen sind.
Die eine besteht in der Tatsache, dass man heute auf früher undenkbare
Weise das Reale und das Virtuelle miteinander kombinieren kann. Es
handelt sich dabei um fortgeschrittene Projektionssysteme, die unter
der Gebäudehülle selbst eingesetzt werden, die eine Art von neuem
Massenmedien-Illusionismus ermöglichen, um dort belebende Eingriffe
vorzunehmen, wo das Umfeld heruntergekommen ist oder keine baulichen
Veränderungen vorgenommen werden können. Eingriffe dieser Art wurden
bereits an archäologischen Fundstätten, verwahrlosten Randbezirken
oder Teilen historischer Altstädte erprobt. Dies stellt einen entscheidenden
Schritt zur Präsenz von IT in der städtischen Umgebung dar. Wir sagen
die Entstehung eines "IT-Barock" voraus. 2006: neue Piazze Navone,
Fontane di Trevi und Trinità dei Monti. Wir arbeiten daran.

Gianni Ranaulo, Media building Pirelli - Milanocentrale
Spa, 1999.
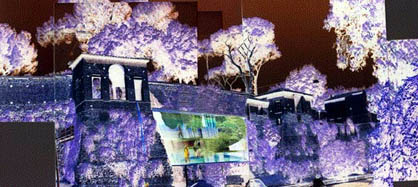
IaN+ (C. Baglivo, L. Galofaro, S. Manna), Unterirdisches
Museum, Villa Medici, Rom.
Schließlich gibt es eine dritte Ebene, die sogar noch weitere Verbreitung
finden kann. Es handelt sich dabei um die Interaktivität im Prozess
des architektonischen Entwurfs selbst. Heute kann man sich, auch wenn
bislang nur wenige davon Gebrauch machen, schnell und leicht in einer
vernetzten Datenwolke bewegen, um, wie oben beschrieben spontan die
Form festzulegen, die diese Wolke annehmen soll. Der Prozess selbst,
Architektur zuerst zu konzipieren, dann zu bauen und schließlich zu
betreiben, erlaubt ein enormes Maß an Interaktivität. Wir nähern uns
einem alten Traum von Chuck Eastman und anderen Wissenschaftlern die
den Bereich CAAD in den siebziger Jahren erforschten.

Wombat (K. Jormakka, J. Gargus,
F. Jamil, M. Ramirez). Trailer, der drei
verschiedene "Wohnpositionen"
einnehmen kann. Position Deleuze.
Nämlich über eine einzige Datenbank von 3D Informationen zu einem
Gebäude zu verfügen, die hierarchisch geordnet ist (also dynamisch,
als würde sie eine mathematische Gleichung darstellen), und die zudem
mit externen Katalogen, Preislisten und 3D Modellen der Bauelemente
und Systemen von externen Fachingenieure für spezielle Berechnungen
vernetzt ist. Und dabei geht es nicht nur um Effizienz. Interaktivität
im Entwurfsprozess bedeutet auch, eine immer flüssigere Methode zu
entwickeln, um für jeden Zweck die bestmögliche Architektur zu erstellen.
Und natürlich erwarten wir uns für das Jahr 2006 auf ganzer Linie
eine bessere Architektur, ohne Adjektive, die von dieser Ebene der
Interaktivität im Entwurfsprozess ausgelöst wird.
NEUE SUBJEKTIVITÄT. Nun wird klar, warum ich im Titel den Ausdruck
"Neue Subjektivität" benutzt habe. Sie ist von allen wünschenswerten
Entwicklungen die entscheidendste. Wenn die Formel der Moderne zurecht
"Neue Sachlichkeit" lautete, kann die Formel heute nur "Neue Subjektivität"
heißen. Nicht länger nur das Existenzminimum, sondern ein Dasein,
dass ausgeweitet und bereichert wird, um den Einzelnen immer mehr
zu einem lebendigen und freien Dasein zu verhelfen, statt zu Nummern
in einem statistischen Jahresbericht.

Peter Anders. "cybrid space" in einem
Architekturbüro. Der virtuelle Bauherr und
Fachingenieur erscheinen wie Geister, die
Architektin ist anwesend. Alle schauen auf das
Modell eines cybriden Projekts. Das Modell wie
auch der architektonische Raum sind cybrid
teils materiell und teils im Cyberspace.
Wenn Transparenz einer Welt die Ästhetik, Ethik, Vernunft und Technik
verschaffte, die mit rationalen Mitteln den Fortschritt ermöglichen
wollte und versuchte, für die Arbeitermassen der Industrie einen höheren
Lebensstandard zu schaffen - und das ist ja geglückt! -, wünsche ich
mir, dass Interaktivität dazu beiträgt, heutige Gedanken auf eine
Architektur zu fokussieren, die sich, nachdem sie die Objektivität
der Bedürfnisse überwunden hat, der Subjektivität der Wünsche zuwendet.
Antonino Saggio
|
|
[18jul2004] |